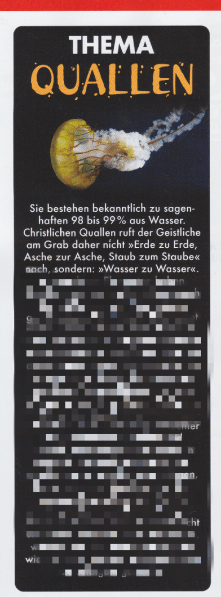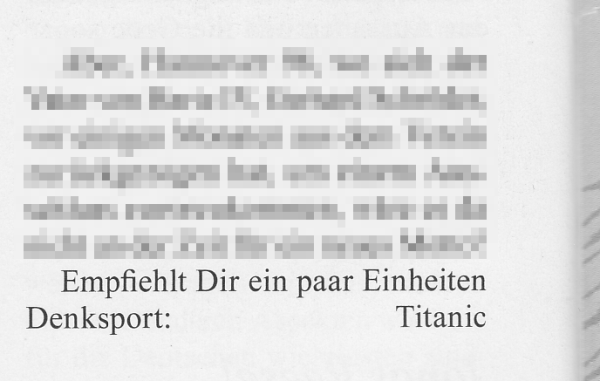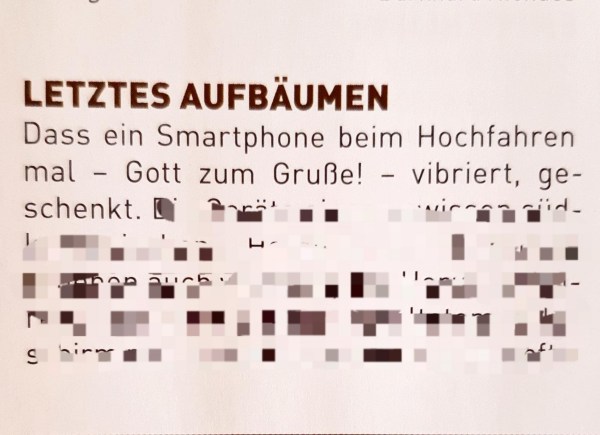[zuerst erschienen in konkret 8/21]
Auf ihrem live gestreamten Spaziergang über eine Berliner Coronaleugner-Demo im vergangenen Sommer meint Fernsehmoderatorin Dunja Hayali mehrfach, Menschen »wirklich von ganz rechts bis ganz links« sehen zu müssen. Für »ganz links« hält sie demzufolge wohl rechte esoterische Hippies in Pluderhosen. Die autonome Antifa jedenfalls war nicht vor Ort. Wo sich Rechtsextreme tummeln, muss in diesem Land sofort auch vorm Linksextremismus gewarnt werden, denn der demokratiefundierenden Hufeisentheorie zufolge bedrohen beide »unsere Art zu leben«.
In die Kinos passt da gut die Verfilmung eines satirischen Kästner-Romans, mit der dieser »vor dem Abgrund warnen (wollte), dem sich Deutschland und damit Europa näherten«. Kästner mag die historische Erfahrung der Wirkungslosigkeit von Satire gefehlt haben, heutzutage braucht niemand mehr so naiv zu sein.
Außer dem »Tatort«- und »Polizeiruf 110«-Regisseur Dominik Graf, der den »Fabian« zwar nicht in die Gegenwart transponiert, ihn aber in dieser für noch die Blindesten gut sichtbar vertäut: Eingangs begleiten wir in einer Berliner U-Bahnstation der Jetztzeit zeitgenössisch schlecht gekleidete Personen über den Bahnsteig, durch den Tunnel und, ein Hakenkreuzplakat passierend, die Treppe hoch, und befinden uns oben im Jahre 1931, wo ein Weltkriegsversehrter dem am Geländer lehnenden Jakob Fabian sein Leid klagt. Mitten im Film laufen Figuren – ein bedeutungsschwangerer und mit acht Filmsekunden wenig subtil einmontierter Anachronismus – auch noch über Stolpersteine.
Niemand soll nachdenken müssen, ob Kästners Roman über die heutige Zeit noch etwas zu sagen hätte. Wenn Fabian, der sich überlegen dünkende bloße Beobachter der Verhältnisse, die Nazis hasst, für die kommunistische Agitation seines Freundes Stephan Labude aber nur Spötteleien und distanzierende Ironie übrighat, hängt die Leinwand voller Hufeisen, und die allermeisten können beruhigt sein.
*
Deutschlands Künstlerhoffnung unserer Mütter, unserer Väter, Hauptdarsteller Tom Schilling hat ein anderes Problem des Films zwar verstanden, wenn er im Interview radebrecht: »Es ist gerade bei Roman-Verfilmungen manchmal so’n bisschen tricky, weil es wirkt dann doch alles sehr geschrieben. Und manchmal ist es besonders, da knallt es so raus, wenn man so Drehbücher hat, wo dann manche Sätze original sind aus dem Kästner-Text und manche halt vom Drehbuchautor. Das hörst du immer, das ist ’n ganz anderer Sound und so. Und dass das irgendwie zusammenfindet, dass man da den richtigen Ton findet als Schauspieler, das ist total schwierig.«
Der Film offenbart aber, dass es Schilling (wie auch seinen Kolleg*innen) bei aller Einsicht dann doch zu schwierig war. Einerseits lassen die Drehbuchschreiber ihre Figuren häufig Original-Sätze aus dem Roman aufsagen, etwa solche Fabians über Berlin: »Hinsichtlich ihrer Bewohner ist diese riesige Stadt aus Stein längst ein Irrenhaus. Im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei, im Norden das Elend, im Westen die Unzucht, und in allen Himmelsrichtungen wohnt der Untergang.« Andererseits motiviert sich Labude, sich endlich zur gefürchteten Abgabe seiner Habilitationsschrift durchzuringen, als wäre er frisch gecoachter Marketinghanswurst im Coworking-Space: »Mit dir schaff’ ich das. Wir geben das gemeinsam ab. Jetzt!« Fabian: »Jaa!« Labude: »Jaaa!«
Aber wie soll ein zehnfacher Grimme-Preisträger wie Graf, der das Drehbuch mitverantwortet, sich Kästners Sprache auch anders annähern. »Fabian« krankt daran, dass Graf unbedingt eine emphatisch-literarische Literaturverfilmung sehr nah am Buch und doch »frei nach dem Roman« machen wollte – was seiner Ansicht nach zu bewerkstelligen ist, indem man der Vorlage allerhand Passagen wörtlich entnimmt und ansonsten drumherumzukästnern versucht. Wer sich diese Romanverfilmung ansieht, soll das Gefühl haben, das Buch gelesen zu haben. Doch am Ende klingt alles, wie deutscher Fernsehfilm nun mal klingt.
Die Off-Erzählstimmen, aufgeteilt in eine männliche und eine weibliche, sagen zumeist ebenfalls Originalsätze auf und erzählen uns entweder das, was zu zeigen man zu faul oder unfähig war, oder das, was wir ohnehin schon sehen. »Schaperstraße«, liest der Erzähler das Straßenschild mit der Aufschrift »Schaperstraße« vor und nagelt uns mit der »4« auch noch die gezeigte Hausnummer ins Hirn. Warum? Damit noch die Unkonzentriertesten (C. Lindner) sofort kapieren, dass Fabians Liebespartnerin Cornelia Battenberg im selben Haus ein Zimmer mietet wie er.
*
Überhaupt: die Frauen im Film. Ein Feuilletonist kann selbsttrunken formulieren, »Fabian oder Der Gang vor die Hunde« sei »eine große, verzweifelte, zum Verzweifeln schöne Liebesgeschichte«, weil Graf die im Roman gar nicht derart präsente Liebesgeschichte zum zentralen Gegenstand aufbläht. Auch reibt er uns dick vor die Augen, wie sich Battenberg, die Rechtsreferendarin bei der Filmgesellschaft, dem Filmmogul Edwin Makart an den Hals und ins Bett wirft. Trägt sie im Film den Wunsch, Schauspielerin zu werden, schon mit ins Referendariat, ist es im Buch der lüsterne Makart, der ihr eine große Rolle anbietet.
Kästner lässt Battenberg das Geschlechterverhältnis diagnostizieren: »Wir sollen weinen, wenn ihr uns fortschickt. Und wir sollen selig sein, wenn ihr uns winkt. Ihr wollt den Warencharakter der Liebe, aber die Ware soll verliebt sein. Ihr zu allem berechtigt und zu nichts verpflichtet, wir zu allem verpflichtet und zu nichts berechtigt, so sieht euer Paradies aus.« Graf legt diese Worte Labude – als fast habilitierter Mann zum Urteilen freilich qualifizierter – in den Mund: »Was wir wollen, ist der Warencharakter der Liebe. Aber die Ware soll verliebt sein in uns.« Und die Selbstkritik ehrt ihn noch.
Keine der Frauenfiguren kommt im Film anders weg denn als verkommenes, verlottertes Weib – mit Ausnahme der guten Mutter Fabians. Für sie erfindet das Drehbuch wesentlich mehr Anteil und Funktion, die Marienhaft-Moralische vom Dresdner Umland soll die luziferischen Berlinerinnen kontrastieren. Wie reaktionär.
Schilling empfiehlt den Film unter anderem »allen, die ein Herz haben, oder so« und »allen, die gerne Filme gucken«. Jawoll, ihnen viel Vergnügen damit.